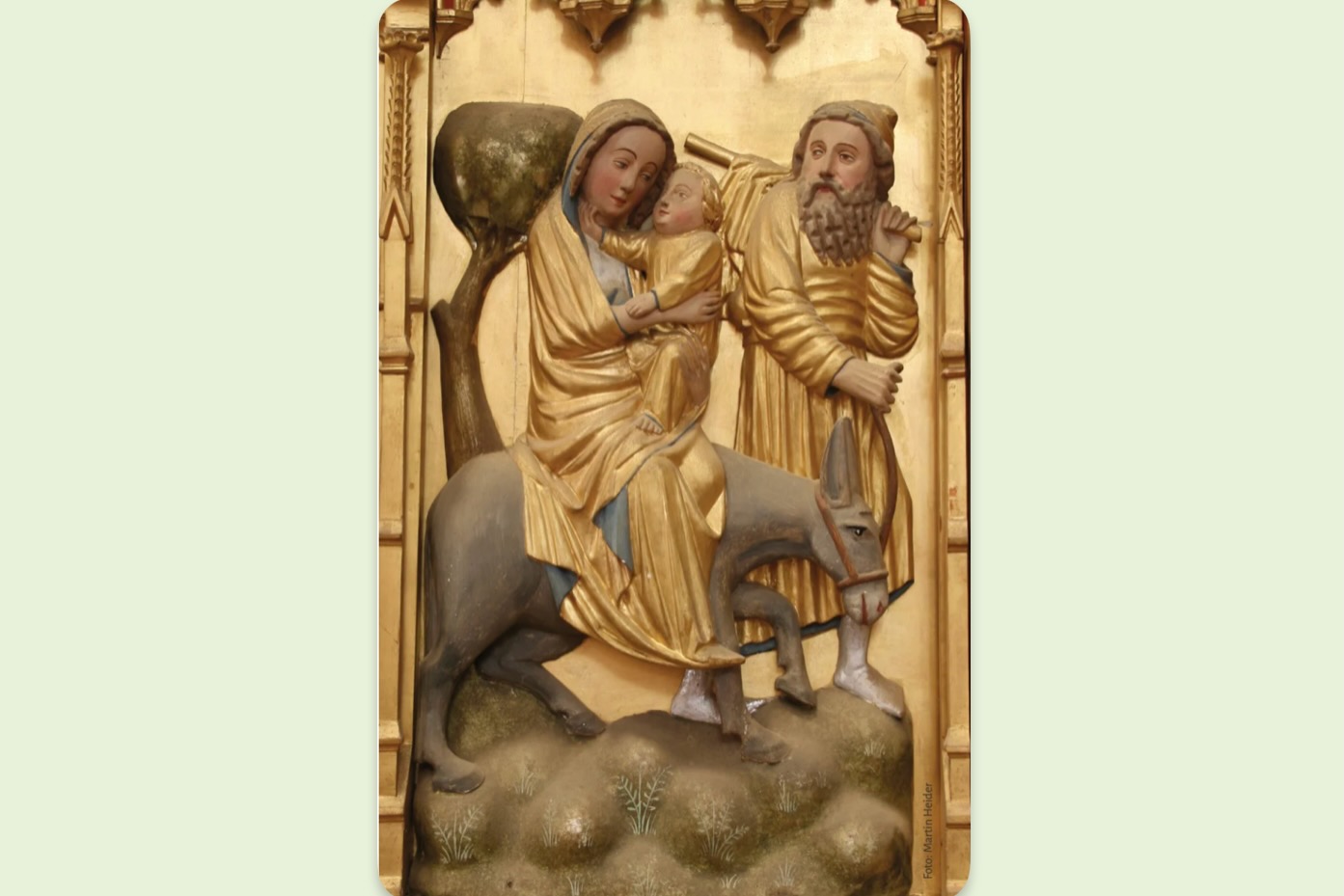Heilkraut des Monats: unsere Ruta!
von Rita Roßmann
Wir wollen künftig immer ein „Heilkraut des Monats“ vorstellen. Heute starten wir damit. Im Mittelpunkt steht die „Ruta“.
In diesem Frühjahr sprach mich bei meinem ersten Pflegeeinsatz im Klostergarten, ich bin Neuling in der ehrenamtlichen Klostergartengruppe, eine Besucherin an. Sie wollte mir ihre große Freude über das wunderschöne Exemplar der „Ruta“ mitteilen. Sie schwärmte regelrecht.
Ruta? Hatte ich noch nie gehört. Meine Neugier war geweckt, also machte ich mich auf den Erkundungsweg.
Jetzt im Juli steht unsere Weinraute – „Ruta graveolens“ der wissenschaftliche Name nach der binären Nomenklatur von Linne – in einem unserer vielen Kastenbeete in voller Blüte. Sie präsentiert sich im Alter von 22 Jahren als ein majestätisch wirkender und stolzer 90 cm hoher Halbstrauch mit grünlich gelben Blüten, die Trugdolden bilden. Die Blätter sind zwei- bis dreifach gefiedert, schimmern blaugrün und erscheinen im Gegenlicht durch eingelagerte Öltröpfchen punktiert. Die Blätter enthalten bestimmte sekundäre Pflanzenstoffe, die phototoxische Reaktionen auslösen können. Wenn diese Stoffe auf die Haut gelangen und diese der Sonne ausgesetzt ist, kann es zu Hautreaktionen wie Blasenbildung, Rötung oder Schwellung kommen. Vorsicht ist geboten!
Der Duft der Weinraute lockt zahlreiche Insekten an, ihr zuckerreicher Nektar dient Bienen als gehaltvolle Nahrung. Ruta gedeiht am besten auf trockenen, locker steinigen, stickstoff- und kalkreichen Lehmböden. Die Pflanze ist im botanischen System der Familie der Rautengewächse zugeordnet, auch Orangen und Zitronen gehören dazu. Die Ruta graveolens ist winterhart und lässt sich gut schneiden.

Die Heimat der Weinraute liegt in Südosteuropa. Die Weinraute zählte zu den wichtigsten Kräutern, die in der Capitulare de villis- der Landgüterverordnung um 800 von Karl dem Großen- aufgeführt sind. Die Pächter seiner Güter sowie auch die Mönche wurden angewiesen, diese Pflanzen im gesamten Reich zu kultivieren. Der Abt Walhalafried Strabo (808-849) vom Kloster Reichenau beschreibt in seinem Gartengedicht auch die Weinraute.
Im Mittelalter nahm die Weinraute eine herausragende Rolle in der entstehenden Medizin ein: Sie wurde gegen Husten, Kopf-, Ohren- und Augenschmerzen eingesetzt – und galt zudem als Mittel, um Männer impotent und Frauen unfruchtbar zu machen. Sie wurde als Schutzpflanze gegen die Pest eingesetzt und war sicher auch deswegen bis zum 18. Jh. stetiger Bestandteil von Haus- und Kräutergärten. Darüber hinaus galt die Weinraute als Zauberpflanze, die vor bösen Geistern, auch vor dem Teufel schützen sollte.
Heute hat der Anbau der Weinraute kaum noch Bedeutung, aber Baumschulen verzeichnen eine zunehmende Nachfrage. Von allen im Mittelalter gepriesenen Wirkungen ist heute vorwiegend die Verwendung als Gewürz übrig geblieben. Die Blätter der Weinraute schmecken sehr kräftig und leicht bitter, was an den enthaltenen sekundären Pflanzenstoffen wie Rutin liegt. Die Blätter der Pflanze können zwischen Juni und August geerntet werden. Die Weinraute ist giftig, wenn man zu viel davon konsumiert. Insbesondere Schwangere sollten vorsichtig sein, weil die Weinraute Wehen auslösen kann.
Die Weinrautenblätter können in kleinen Mengen zum Verfeinern von Suppen, Salaten, Soßen, Eintöpfen, Fleisch- und Fischgerichten und auch in Marmeladen eingesetzt werden. Ich werde es noch ausprobieren! Frisch wird die Ruta graveolens auch als Weingewürz eingesetzt und ist auch Zutat im italienischen Grappa. Das aus den Blättern und Samen gewonnene ätherische Öl wird als Grundstoff gegen Rheuma und Gicht in der Naturheilkunde verwendet.
Ruta graveolens ist eines der am häufigsten verwendeten Arzneimittel der Homöopathie und die Globuli finden häufig Anwendung bei Sportverletzungen, Entzündungen der Knochenhaut sowie bei Muskel- und Rückenschmerzen durch Überanstrengung. Auch bei Augenschmerzen wird Ruta graveolens in der Homöopathie heute noch eingesetzt.

Übrigens: Die Besucherin, die so von der Ruta schwärmte, war – wie ich im Gespräch erfuhr – selbst Homöopathin.
Ich hätte nie gedacht, dass die Arbeit im Klostergarten ein so weites Feld an Geschichte, Klosterkunde, Pflanzenkunde und Heilkunde umfasst. Es macht auch große Freude, in diesem engagierten Team gemeinsam den Klostergarten für alle Besucherinnen und Besucher zu einem besonderen Ort zu machen.
Mehr über die AG Klostergarten erfahren Sie > hier. Kommen Sie vorbei und entdecken Sie unsere Schätze! Oder besser noch: Machen Sie mit!